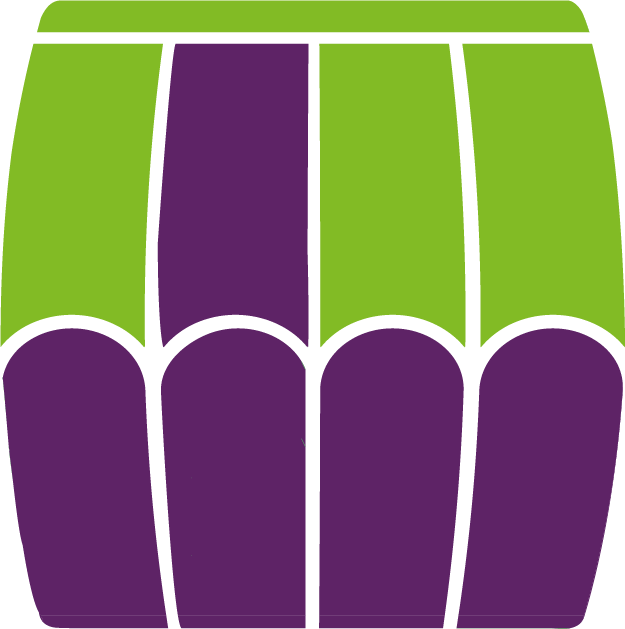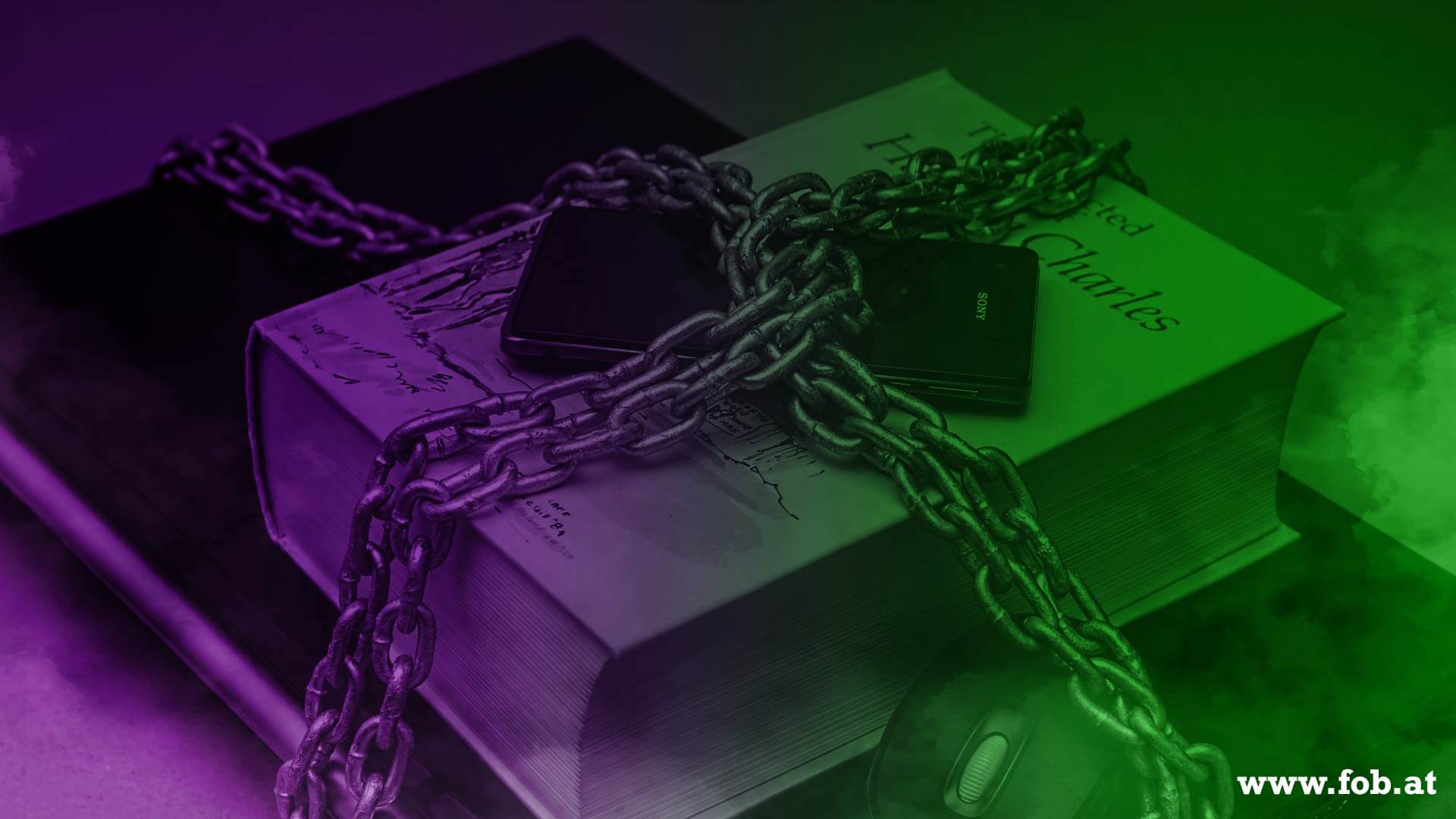Die Abschaffung der traditionellen Vorwissenschaftlichen Arbeit wird vom Bildungsminister Martin Polaschek als notwendige Modernisierung dargestellt. In Zeiten von KI-Programmen wie ChatGPT sei eine umfangreiche schriftliche Arbeit „nicht mehr zeitgemäß“. Stattdessen sollen die rund 17.000 Maturanten jährlich auch kreative Arbeiten wie Podcasts oder Videoreportagen einreichen können.
Fortschritt oder Rückschritt?
Doch die neuen Möglichkeiten stoßen nicht nur auf Zustimmung. Kritiker befürchten, dass die neuen Formen der Abschlussarbeit die Anforderungen an die Schüler verringern und die Vergleichbarkeit der Leistungen erschweren könnten. Zudem hängt die Einführung der alternativen Formate stark von der Zustimmung der Betreuungslehrer ab, was zu regionalen Unterschieden führen könnte.
Gewaltprävention: Zu viel Bürokratie?
Eine weitere Neuerung betrifft alle Schulen: Ab Herbst müssen diese über ein Kinderschutzkonzept samt Risikoanalyse verfügen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Gewalt an Schulen präventiv zu begegnen. Jedes Schulgebäude soll ein eigenes Kinderschutzteam haben, zudem wird ein Verhaltenskodex für alle Beteiligten eingeführt.
Auch hier gibt es kritische Stimmen. Zwar wird der Schutz der Kinder grundsätzlich begrüßt, jedoch wird die zusätzliche Bürokratie in Schulen mit ohnehin schon knappen Ressourcen als problematisch angesehen. Lehrerverbände warnen vor einer Überlastung der Schulen und bezweifeln die praktische Umsetzung dieser Konzepte.
Gebärdensprache im Lehrplan: Lange überfällig?
Eine positive Neuerung ist die Einführung der österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) als Wahlpflichtfach an Gymnasien. Diese Maßnahme ermöglicht es gehörlosen und hörenden Schülern, ÖGS anstelle von traditionellen Fremdsprachen zu wählen und darin zu maturieren. Trotz der seit 2005 verfassungsrechtlichen Anerkennung der ÖGS kam diese bisher kaum im Schulunterricht vor.
Diese Änderung wird von Experten als wichtiger Schritt in Richtung Inklusion gewertet, obwohl auch hier die praktische Umsetzung und die Verfügbarkeit qualifizierter Lehrkräfte noch offen sind.
Fazit und Ausblick
Die Reformen im Bildungswesen zielen darauf ab, Schulen moderner und sicherer zu gestalten. Während die Einführung alternativer Abschlussarbeiten und die Stärkung des Kinderschutzes als Fortschritt gewertet werden, bleibt abzuwarten, wie diese Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden. Die Kritik an den Plänen zeigt, dass das Bildungsministerium noch viel Überzeugungsarbeit leisten muss, um die Akzeptanz bei Lehrkräften, Eltern und Schülern zu sichern.