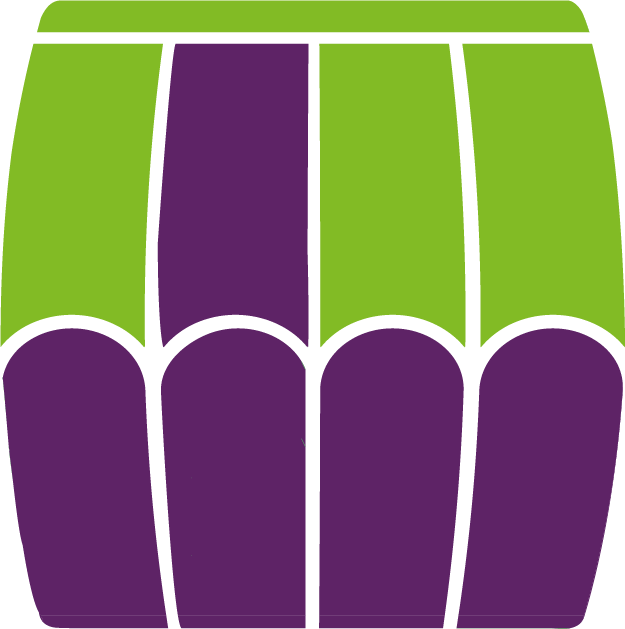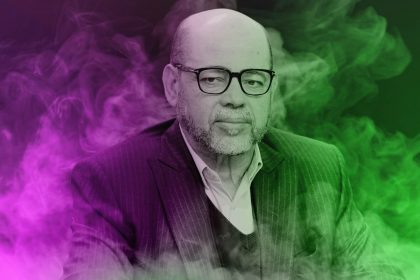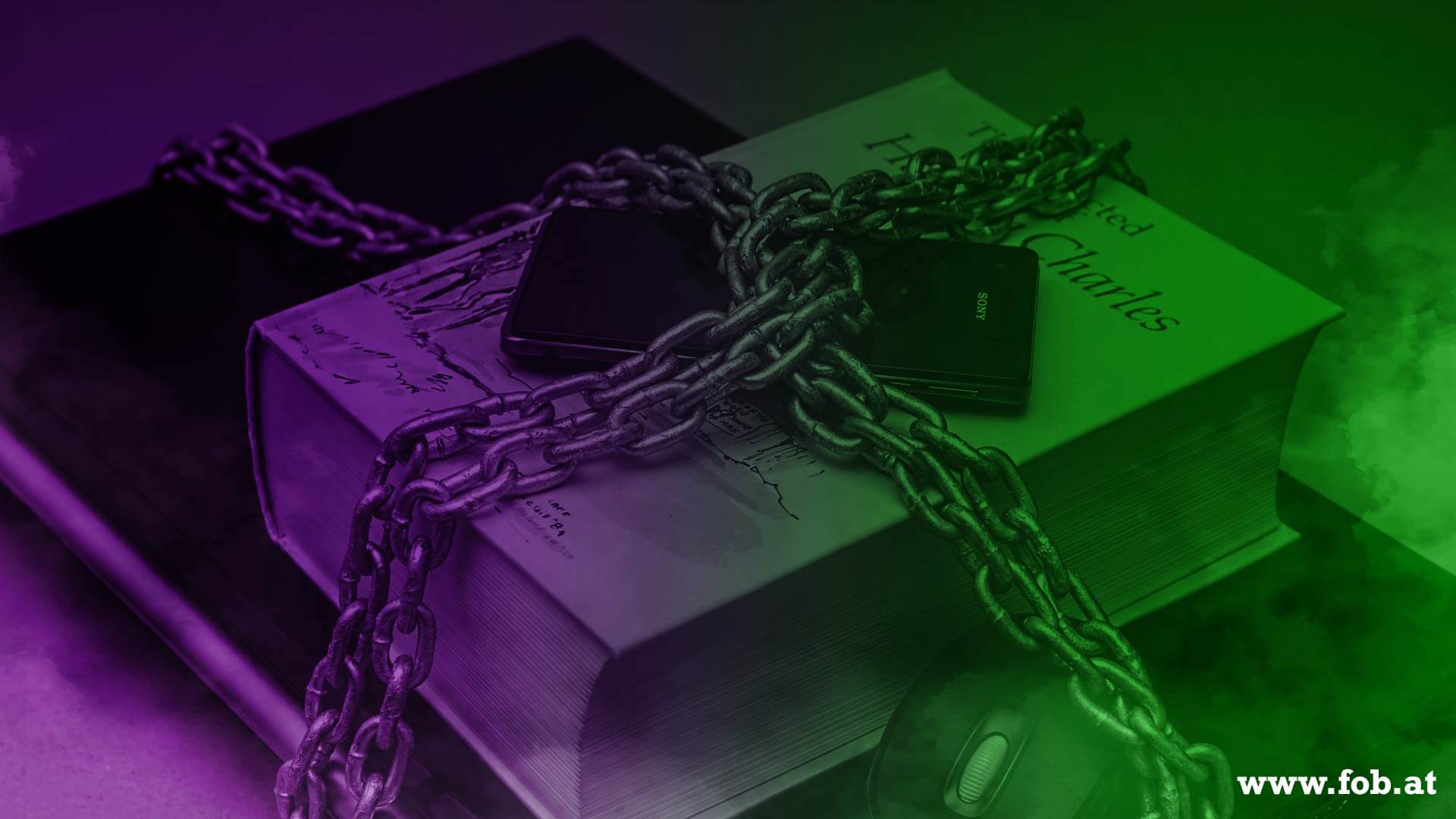Der Historiker Heiko Heinisch zieht eine Parallele: Während die Gründung einer Schule durch rechte Aktivisten wie Martin Sellner einen Aufschrei der Empörung nach sich ziehen würde, scheint die Schulführung durch den Millî Görüs-Verein kaum für Aufsehen zu sorgen. Dieses Phänomen beleuchtet Heinisch mit scharfen Worten: „Stellen Sie sich vor, Martin Sellner würde eine Schule gründen – der Aufschrei wäre groß. Aber wenn ein Millî Görüs-Verein Schulerhalter ist, scheint das niemanden zu stören.“
Studie enthüllt Problematik
Heinisch, zusammen mit Hüseyin Çiçek und Jan-Markus Vömel, hat eine tiefgehende Studie über die islamische Gemeinschaft Millî Görüs erstellt. Sie kommen zu dem Schluss, dass es sich um eine türkische Ausprägung des politischen Islam handelt, die sich hauptsächlich durch die Fokussierung auf die Türkei als Zentrum der islamischen Welt von der Muslimbruderschaft unterscheidet. Heinisch fasst zusammen: „Millî Görüs ist die türkische Variante des politischen Islam.“ (Aktuelle FOB-Enthüllung zum Nachlesen: Sobotka empfängt Erdogan-Lobbyisten)
Zweifelhafte Schulerfolge
Die zwei Wiener Schulen unter dem Dach von SOLMIT, einem Verein der Millî Görüs, zeigen erstaunliche Entwicklungen: Während anfänglich die Hälfte der Schüler die Prüfungen nicht bestand, verbesserten sich die Ergebnisse, nachdem die Schule in Simmering das Öffentlichkeitsrecht erhielt. Das Bildungsministerium, vertreten durch Martin Polaschek, betont, dass alle formalen Auflagen erfüllt wurden, ohne jedoch auf die Qualität des Unterrichts oder die Inhalte einzugehen.
Problematische Abgrenzung
Neben der Qualität der Bildung ist es die geforderte Segregation von der Mehrheitsgesellschaft, die besorgt macht. Heinisch zitiert einen Imam, dessen Worte die Abgrenzung von der nicht-muslimischen Gesellschaft unterstreichen: „Nun Jugendliche, wir haben darauf zu achten, mit wem wir Freundschaften schließen. Wenn jemand uns vom Wege Allahs abbringt, dann ist er kein Freund für dich.“
Frage der Integration
Die Schule selbst beteuert, offen für alle Konfessionen zu sein und den österreichischen Lehrplan zu unterrichten. Auf die Nachfrage, wie dies mit den problematischen Predigten zu vereinbaren sei, distanziert sich die Schule und erklärt, dass dies „in keinem Zusammenhang mit unserer Bildungsarbeit“ stehe. Trotz der Versicherung, dass es nicht-muslimische Kinder und Eltern an der Schule gibt, bleibt die Frage nach der Integration und Offenheit bestehen.
Fazit und Ausblick
Der Kurier-Artikel richtet seinen Fokus auf die komplexe Problematik der Schulbildung im Kontext des politischen Islam in Wien. Während formale Auflagen erfüllt sein mögen, bleiben Fragen bezüglich der inhaltlichen Ausrichtung. Insbesondere muss die Qualität des Unterrichts und der sozialen Integration in Frage gestellt werden.